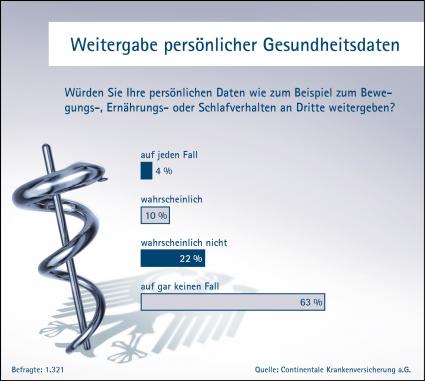
Eine deutliche Mehrheit der Bevölkerung möchte ihre
Gesundheitsdaten nicht an Dritte geben. Die meisten auch dann nicht,
wenn es dafür im Gegenzug finanzielle Anreize gibt / Fast alle achten
auf die eigene Gesundheit, aber nur ein Fünftel erfasst
Gesundheitsdaten / 6 Prozent nutzen Gesundheitsapps und ähnliches
regelmäßig.
Gesetzliche Krankenkassen wollen Smartwatches bezuschussen; ein
privater Versicherer kündigte an, die gesunde Lebensweise seiner
Kunden in die Beitragshöhe einfließen zu lassen. Überwacht werden
solle das per App. Da stellt sich die Frage: Werden wir demnächst zum
„gläsernen Versicherten“? Die Antwort lautet: Nein. Das belegt die
aktuelle Continentale-Studie 2015. Ein Ergebnis: 63 Prozent der
Bürger lehnen es klar ab, ihre Gesundheitsdaten an Dritte
weiterzugeben, weitere 22 Prozent sind immerhin skeptisch. Obwohl die
technischen Möglichkeiten gegeben sind, nutzen derzeit nur 6 Prozent
der Befragten Gesundheitsapps und Co. zur Messung und Speicherung
ihrer Daten.
Angesichts der technischen Entwicklung und aktueller Schlagzeilen
bewegt die Öffentlichkeit nicht zu Unrecht die Frage, ob wir in
Deutschland auf dem Wege zum „gläsernen Versicherten“ sind. Um dieses
Szenario möglich zu machen, müssten drei Faktoren gegeben sein: Die
Erfassung von Gesundheitsdaten, eine elektronische Dokumentation und
die Weitergabe der Daten an Dritte, etwa an Versicherer. Diese
Voraussetzungen sind derzeit überwiegend nicht gegeben, wie die
repräsentative Bevölkerungsbefragung „Continentale-Studie 2015 – Auf
dem Weg zum gläsernen Versicherten?“ ergab. Für die Erhebung wurden
1.321 Personen ab 25 Jahren befragt.
Bürger haben Gesundheit im Blick, halten Daten aber überwiegend
nicht fest
Um gesundheitsförderliches oder -schädliches Verhalten beobachten
und daraus Maßnahmen ableiten zu können, müssten die Bürger Daten
erfassen. Das ist aber nur in geringem Maße der Fall. Zwar sagt die
Mehrheit der Bevölkerung, dass sie auf ihre Gesundheit achtet. Im
Schnitt gaben 53 Prozent an, die acht abgefragten Gesundheitsaspekte
(Ernährung, Bewegung, Gewicht, Schlaf, Blutdruck/Puls,
Alkohol-/Zigarettenkonsum, Kalorienverbrauch, Krankheitsverläufe) im
Blick zu haben. Fast alle Befragten, nämlich 95 Prozent, achten
mindestens auf eines dieser Kriterien, aber nur 19 Prozent erfassen
die Ergebnisse ihrer Beobachtungen.
Ältere Menschen machen sich mehr Notizen
Nur bei einer Gruppe ist der Unterschied zwischen „auf
Gesundheitsdaten achten“ und „diese dokumentieren“ kleiner:
Diejenigen, die auf mehrere Kriterien achten, dokumentieren ihre
Beobachtungen häufiger. Von den Befragten, die auf sieben oder sogar
alle der aufgezählten Daten häufig oder sehr häufig achten, machen
sich 32 Prozent mindestens zu einem Punkt Notizen. Da die eigene
Gesundheit mit steigendem Alter immer mehr zum Thema wird, wundert es
nicht, dass 63 Prozent dieser Personen 50 Jahre und älter sind.
Nur 6 Prozent nutzen derzeit Gesundheitsapps und Co.
Um zum „gläsernen Versicherten“ zu werden, muss aber auch die
Bereitschaft bestehen, die eigene Gesundheit mit technischen,
internetfähigen Geräten zu überwachen. Allen Schlagzeilen über
Gesundheitsapps und Smartwatches zum Trotz nutzen aber nur 2 Prozent
solche Möglichkeiten intensiv und 4 Prozent gelegentlich. Weitere 4
Prozent geben an, dass sie Apps oder Ähnliches zwar in der
Vergangenheit in Gebrauch hatten, sie mittlerweile aber schon nicht
mehr nutzen. 17 Prozent der Befragten, die bisher keine Daten erhoben
haben, könnten sich allerdings vorstellen, dass sie künftig auf
technische Angebote zugreifen. Die große Mehrheit, 72 Prozent der
Bevölkerung, hat eine klare Haltung: „Das kommt für mich nicht
infrage.“
„Early adopter“ nutzen technische Möglichkeiten – aber nicht
dauerhaft
Blickt man mit der statistischen Lupe auf die 6 Prozent der Fans
von Gesundheitsapps und Co., fällt auf: Die meisten Nutzer (12
Prozent) finden sich in der Altersgruppe „30-39 Jahre“. Aber hier ist
auch der Anteil derjenigen, die sich von den Geräten oder Apps
bereits wieder abgewendet haben, am größten (8 Prozent). Es liegt
nahe, dass es sich bei dieser Gruppe um Lifestyle-affine „early
adopter“ handelt, die Trends zunächst gern folgen, ohne letztlich
dauerhaft dabeizubleiben.
Gesundheitsdaten an Dritte geben? 63 Prozent würden das auf keinen
Fall tun
Es bleibt abschließend noch die dritte Frage, ob die Bevölkerung
generell bereit wäre, aufgezeichnete Gesundheitsdaten weiterzugeben.
In der großen Mehrheit ist das nicht der Fall. 63 Prozent würden
diese höchst persönlichen Informationen „auf gar keinen Fall“ an
Dritte weitergeben, weitere 22 Prozent „wahrscheinlich nicht“.
Besonders groß ist die Abneigung bei jungen Menschen im Alter von 25
bis 29 Jahren: 97 Prozent möchten eher keine Weitergabe, 78 Prozent
davon lehnen das sogar kategorisch ab.
Wenn Daten überhaupt weitergeben werden würden, dann gäben sie die
Befragten noch am ehesten an Ärzte (85 Prozent) oder die Familie (74
Prozent). Also an Personen, denen der Einzelne großes Vertrauen
entgegenbringt.
Datenweitergabe an Versicherungen gegen Geld?
Auf der einen Seite ändern selbst finanzielle Anreize diese
Haltung kaum. Denn die Aussage „Für einen finanziellen Vorteil bin
ich bereit, mich von meinem Krankenversicherer mit Hilfe meiner
Gesundheitsdaten überprüfen zu lassen“ lehnen 43 Prozent ab, weitere
36 Prozent der Befragten stehen dieser Aussage skeptisch gegenüber.
Auf der anderen Seite ist bemerkenswert: Für einen finanziellen
Vorteil wären immerhin 30 Prozent der 30- bis 39-Jährigen zur
Datenweitergabe bereit.
Continentale Versicherungsverbund sieht sich bestätigt
Dr. Christoph Helmich, Vorstandsvorsitzender des Continentale
Versicherungsverbundes und Auftraggeber der Studie, ist von den
Ergebnissen nicht überrascht. „Wir sind in unserer Einschätzung
bestätigt worden. Die Bürger sind derzeit sehr zurückhaltend mit der
Weitergabe ihrer persönlichen Gesundheitsdaten.“Bemerkenswert ist
allerdings, dass immerhin 20 Prozent der Befragten und sogar 30
Prozent der 30- bis 39-Jährigen bereit sind, gegen einen finanziellen
Vorteil Daten zu sammeln und auch weiterzugeben. „Denn“, so Dr.
Helmich, „ob ,gläserne Versicherte‘ tatsächlich geringere
Gesundheitskosten verursachen, ist nach allem, was wir heute wissen,
fraglich.“ Dr. Helmich weiter: „Sicher ist dagegen, dass sich bei der
Continentale Krankenversicherung kostenbewusstes Verhalten lohnt. Und
zwar sowohl für den Versicherten in Form von Beitragsrückerstattungen
bei Leistungsfreiheit als auch für das Versichertenkollektiv durch
weniger Leistungsausgaben und ein dadurch niedrigeres Prämienniveau.“
Zur Studie:
Die aktuelle Continentale-Studie 2015 mit dem Titel „Auf dem Weg
zum gläsernen Versicherten?“ findet sich zum Download unter
www.continentale.de/studien. Dort stehen auch Grafiken zur Verfügung
sowie vorangegangene Studien. Seit dem Jahr 2000 wird die Befragung
jährlich durchgeführt und beschäftigt sich mit aktuellen Fragen des
Gesundheitswesens. Wie schon in den vergangenen Jahren wurde sie in
Zusammenarbeit mit dem Meinungsforschungsinstitut TNS Infratest
umgesetzt. Zur „Continentale-Studie 2015“ wurden bundesweit
repräsentativ 1.321 Personen befragt.
Über den Continentale Versicherungsverbund auf Gegenseitigkeit:
Die Continentale ist kein Konzern im üblichen Sinne, denn sie
versteht sich als ein „Versicherungsverbund auf Gegenseitigkeit“.
Dieses Grundverständnis bestimmt das Handeln in allen Bereichen und
in allen Unternehmen. Es fußt auf der Rechtsform der
Obergesellschaft: An der Spitze des Verbundes steht die Continentale
Krankenversicherung a.G. (gegründet 1926), ein Versicherungsverein
auf Gegenseitigkeit – und ein Versicherungsverein gehört seinen
Mitgliedern, den Versicherten. Dank dieser Rechtsform ist die
Continentale geschützt gegen Übernahmen und in ihren Entscheidungen
unabhängig von Aktionärsinteressen.
Pressekontakt:
Bernd Goletz
Continentale Versicherungsverbund auf Gegenseitigkeit
Leiter Unternehmenskommunikation
Tel.: 0231/919-2255
presse@continentale.de